
Menschen mit Behinderungen sind in vielfältiger Weise sportlich aktiv – und zwar im Breitensport und im Spitzensport. Allerdings ist der Sport von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft weniger sichtbar und anerkannt als der Sport von Menschen ohne Behinderungen. Das zeigt sich zum Beispiel in der geringen Berichterstattung über Sportereignisse wie die Paralympics oder die Special Olympics. Es wird aber auch dadurch deutlich, dass paralympische Athlet*innen in der Öffentlichkeit häufig nicht so bekannt sind wie olympische Athlet*innen.
ableistisch
Das Wort kommt vom englischen Begriff «able».
«able» bedeutet «fähig».
Ableistische Vorurteile diskriminieren Menschen mit Behinderung.
ableistisch ist zum Beispiel das Vorurteil:
Menschen mit Behinderungen sind weniger sportlich.
Weil ihr Körper nicht den Vorstellungen
eines «normalen» Körpers entspricht.
inter
«inter» steht für «inter-geschlechtlich».
Inter Menschen sind medizinisch gesehen
nicht männlich und auch nicht weiblich.
Das heisst:
Ihr körperliches Geschlecht ist
nicht klar männlich und auch nicht klar weiblich.
Klasse
Unsere Gesellschaft teilt Menschen in verschiedene Klassen ein.
Je nachdem, wie viel Geld die Menschen haben.
Menschen mit genug oder viel Geld gehören zu einer hohen Klasse.
Menschen mit wenig Geld gehören zu einer tieferen Klasse.
Klassen sind Teil der Struktur unserer Gesellschaft.
klassistisch
Klassistisch sein heisst:
Man grenzt Menschen aus,
weil sie zu einer tieferen gesellschaftlichen Klasse gehören.
Oder aus einer tieferen gesellschaftlichen Klasse kommen.
Zum Beispiel:
Menschen mit viel Geld haben Vorurteile gegen Menschen mit wenig Geld.
Das ist diskriminierend.
Klassistische Diskriminierung kommt immer von einer höheren Klasse
und richtet sich gegen eine tiefere Klasse.
nicht-binär
«binär» bezieht sich auf die 2 Geschlechter: Mann und Frau.
Nicht-binäre Menschen sind Menschen,
die nicht Mann und nicht Frau sind.
Das ist unabhängig von ihrem körperlichen Geschlecht.
Sie sind vielleicht beides gleichzeitig.
Oder zwischen männlich und weiblich.
Oder sie haben gar kein Geschlecht.
queer
«queer» bedeutet in diesen Texten:
nicht heterosexuell.
Queere Menschen sind also zum Beispiel schwul, lesbisch oder bisexuell.
Also: Männer lieben Männer, Frauen lieben Frauen.
Oder man liebt Männer und Frauen.
Rassismus
Rassismus ist eine Diskriminierung von nicht weissen Menschen.
Nicht weisse Menschen werden aus verschiedenen Gründen diskriminiert.
Zum Beispiel:
- weil sie eine dunkle Hautfarbe haben
- weil sie nicht gut Deutsch sprechen
- weil sie eine andere Religion haben als das Christentum
- weil sie andere Traditionen haben als Schweizer Traditionen
Es gibt noch viele andere Gründe.
Aus diesen Gründen denken manche Leute:
Diese Menschen sind «anders».
Sie sind «fremd».
Auch wenn das gar nicht stimmt.
Aber sie schliessen diese Menschen dann aus.
Oder geben ihnen weniger Chancen.
Zum Beispiel im Sport, bei der Wohnungs-Vermietung oder bei der Arbeit.
Sexismus
Sexismus heisst:
Diskriminierung wegen dem Geschlecht.
Vielleicht sagt jemand:
«Du wirfst den Ball wie ein Mädchen.»
Und meint damit: Du wirfst den Ball schlecht.
Dann ist das sexistisch.
trans
Trans Menschen sind Personen,
die sich nicht ihrem biologischen Geschlecht zuordnen.
Zum Beispiel:
Ein Mensch, der als Mann geboren wurde, fühlt sich als Frau.
Oder ein Mensch, der als Frau geboren wurde, fühlt sich als Mann.
Trans Menschen machen manchmal auch eine Geschlechts-Angleichung.
Damit sie statt wie ein Mann wie eine Frau aussehen.
Oder umgekehrt.
Alle fett markierten Wörter in den Texten sind im Glossar erklärt.
Viele Menschen mit Behinderungen machen Sport.
Manche machen Sport in ihrer Freizeit.
Andere sind im Spitzensport aktiv.
Aber der Sport von Menschen mit Behinderungen ist nicht so bekannt wie der Sport von Menschen ohne Behinderungen.
Grosse Sport-Ereignisse in diesem Bereich sind zum Beispiel die Paralympics oder die Special Olympics.
Über diese Ereignisse wird aber weniger berichtet als über die Olympischen Spiele für Menschen ohne Behinderung.
Und die paralympischen Sportler*innen sind weniger bekannt als die olympischen Sportler*innen.
Ideal-Bilder und Vorurteile gegen Menschen mit Behinderungen
Warum ist der Sport von Menschen mit Behinderungen weniger sichtbar?
Viele Menschen haben eine bestimmte Vorstellung von einem sportlichen Körper.
Man sagt auch: Ideal-Bild.
Zu diesem Ideal-Bild gehören Muskeln und Leistungsfähigkeit.
Ein sportlicher Körper kann zum Beispiel schnell rennen,
hoch springen oder einen Ball weit werfen.
Viele Sportler*innen ohne Behinderung entsprechen nicht diesem Ideal-Bild.
Aber besonders Menschen mit Behinderung erfüllen diese Vorstellung nicht.
Viele Menschen denken:
Die sportliche Leistung von Menschen mit Behinderungen ist weniger gut.
Auch wenn das gar nicht stimmt.
Deshalb werden ihre sportlichen Leistungen nicht gleich wertgeschätzt.
Ein anderes Vorurteil ist:
Menschen mit Behinderungen haben wenig Interesse am Sport.
Solche und ähnliche Vorurteile gegen Menschen mit Behinderung
nennt man auch «ableistisch».
Ableistische Vorurteile diskriminieren Menschen mit Behinderung.
Menschen mit Behinderungen gelten gemäss diesen Vorurteilen
als «anders» oder «unnormal».
Weil sie vielleicht nicht den gesellschaftlichen Vorstellungen
über «normale» Körper und Fähigkeiten entsprechen.
Wichtig: Vielfalt in der Vielfalt
Menschen mit Behinderungen sind verschieden.
Sie haben zum Teil sehr unterschiedliche Formen von Behinderungen.
Manche haben eine sichtbare Behinderung.
Andere eine unsichtbare.
Es ist wichtig, dass man diese Unterschiedlichkeit auch im Sport berücksichtigt.
Ein anderer wichtiger Punkt ist:
Menschen mit Behinderungen können auch mehrfach diskriminiert werden.
Also nicht nur wegen ihrer Behinderung.
Sondern zum Beispiel auch wegen ihrem Geschlecht.
(Mehr Informationen dazu unter: Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt.)
Viele Leute haben eine bestimmte Vorstellung,
was ein «normaler» Mann oder eine «normale» Frau ist.
Menschen mit Behinderungen entsprechen oft nicht dieser Vorstellung.
Gegen Männer mit Behinderungen gibt es oft das Vorurteil:
Sie sind nicht genug leistungsfähig und männlich.
Gegen Frauen mit Behinderungen gibt es oft das Vorurteil:
Sie sind nicht genug weiblich.
Entweder, weil sie wegen ihrer Behinderung
nicht dem Schönheits-Ideal für Frauen entsprechen.
Oder weil sie zu sportlich sind.
Das gilt vor allem für Frauen im Leistungs-Sport
oder in typischen Männer-Sportarten.
Manche Menschen mit Behinderungen werden zusätzlich diskriminiert,
weil sie nicht viel Geld haben.
Auch in der Schweiz sind mehr Menschen mit Behinderungen
von Armut betroffen als Menschen ohne Behinderung.
Wenn Menschen mit Behinderungen nicht genug Geld haben,
können sie keine Sport-Angebote nutzen.
Und sie werden von der Gesellschaft ausgeschlossen.
(Mehr Informationen dazu unter: Sport und Armut.)
Handeln: Was kann ich tun?
Die Haltung und das Handeln
von Kursleitenden und Trainer*innen sind wichtig.
Sie können damit die Diskriminierung
von Menschen mit Behinderungen vermeiden.
Damit sich alle Menschen im Sport wohl und sicher fühlen.
Und immer mehr Sport-Angebote auch
für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind.
Das können Sie als Kursleitende und Trainer*innen tun:
- Ein Bewusstsein für Inklusion und die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen entwickeln.
Sport-Angebote sollen inklusiv sein.Sie sollen Menschen mit Behinderungen nicht diskriminieren.
Dazu müssen Sportler*innen und Sport-Leitende ohne Behinderungen ihre Vorurteile hinterfragen.
Informieren Sie sich über Menschen mit Behinderungen im Sport.
Und darüber, wie diese Menschen im Sport diskriminiert werden.
Am besten tun Sie das gemeinsam mit anderen Menschen in Ihrem Sport-Verein.
Sprechen Sie offen über Vorurteile.
Fragen Sie sich:
Für welche Leistungs-Normen und Körper-Normen stehen diese Vorurteile?
Hinterfragen Sie diese Normen.
Gehen Sie davon aus:
Menschen mit Behinderungen interessieren sich
genauso sehr für Sport wie Menschen ohne Behinderungen.
Machen Sie sich bewusst:
Nicht jede Behinderung ist sichtbar.
Gehen Sie davon aus:
In jeder Gruppe sind Menschen mit Behinderungen anwesend.
- Inklusive Sport-Angebote gestalten.
Inklusive Sport-Angebote sind für Menschen mit und ohne Behinderung.
Man kann ein Sport-Angebot von Anfang an inklusiv planen.
Vielleicht gibt es auch eine Anfrage
von Eltern von Kindern mit Behinderungen.
Dann können Sie mit diesen Tipps ein inklusives Sport-Angebot gestalten.
Entscheiden Sie gemeinsam mit den Menschen in Ihrem Sport-Verein:
Können Sie ein inklusives Sport-Angebot gestalten?
Zum Beispiel für Kinder und Jugendliche.
Wenn ja, wie können Sie das Sport-Angebot inklusiv gestalten?
Organisationen wie PluSport, Special Olympics oder
J+S (Jugend+Sport) bieten Beratung und finanzielle Unterstützung.
Nutzen Sie diese Unterstützung.
(Mehr dazu unten bei «Wo finde ich Unterstützung?».)
Denken Sie an die Orte, wo normalerweise Ihr Sport-Angebot stattfindet.
Klären Sie ab:
Sind diese Orte barrierefrei und zugänglich?
Zum Beispiel Parkplätze, Garderoben, Duschen und WCs.
- Inklusive Sprache verwenden.
Auch über die Sprache können wir Menschen mit Behinderungen zeigen:
Du bist willkommen.
Du kannst dich hier sicher fühlen.
Deshalb ist ein bewusster Umgang mit Sprache im Sport wichtig.
Sagen Sie nicht:
Jemand «leidet» an einer Behinderung.
Menschen leben mit einer Behinderung.
Und es gehört mehr zu ihnen als nur ihre Behinderung.
Sagen Sie deshalb «Menschen mit Behinderung».
So stellen Sie den Menschen in den Vordergrund.
«Menschen mit Behinderung» bedeutet auch:
Diese Menschen sind nicht behindert.
Sondern sie werden behindert.
Durch Dinge und andere Menschen in unserer Gesellschaft.
Im Sport spricht man auch oft von «Beeinträchtigung».
Dieser Begriff betont:
Jemand hat eine individuelle körperliche, geistige
oder psychische Einschränkung.
Der Begriff kann deshalb negativ wirken.
Benutzen Sie ihn vorsichtig.
Wenn Sie Bilder, Fotos oder Videos verwenden:
Wählen Sie Materialien,
die Menschen mit unterschiedlichem Aussehen beim Sport zeigen.
Auch Menschen mit Behinderung.
Denn Vielfalt soll sichtbar sein.
- Diskriminierung begegnen.
Als Kursleitende oder Trainer*innen sind Sie dafür verantwortlich:
Der Kurs oder das Training soll für alle Beteiligte
ein sicherer Raum ohne Diskriminierung sein.
Wie Sie auf Grenz-Überschreitungen reagieren,
hat einen Einfluss auf die Grund-Stimmung im Training.
Sie bestimmen ausserdem:
Welche Regeln gelten im Kurs?
Sagen Sie deutlich, was Sie erwarten:
gegenseitigen Respekt und Fairness.
Also keine sexistischen, queer-feindlichen
oder sonst diskriminierenden Sprüche.
Wird jemand diskriminiert, beleidigt, unfair behandelt oder abgewertet?
Dann schreiten Sie sofort ein.
Machen Sie die diskriminierende Person darauf aufmerksam:
Dein Verhalten war falsch.
Sprechen Sie dabei ruhig, klar und respektvoll.
Reagieren Sie auf jede Diskriminierung.
Auch wenn keine betroffenen Personen vor Ort sind.
Sprüche wie «Das war aber ein schwuler Pass»
oder «Bist du behindert?» sind immer diskriminierend.
Auch wenn kein schwuler Sportler und
kein Mensch mit Behinderungen anwesend ist.
Reagieren Sie je nach Situation
vor der ganzen Gruppe auf Diskriminierungen.
Führen Sie nach dem Training ein klärendes Einzelgespräche.
Notieren Sie den Vorfall.
Melden Sie den Vorfall, falls die Person ihr Verhalten nicht ändert.
Bei Konflikt-Situationen:
Versuchen Sie,
offen und gerecht zwischen den Teilnehmenden zu vermitteln.
Verteilen Sie keine übertriebenen Strafen.
Suchen Sie gemeinsam nach Lösungen:
Wie können wir eine solche Situation in Zukunft vermeiden?
So stärken Sie das gegenseitige Vertrauen nach und nach.
Wo finde ich Unterstützung?
Verschiedene Links am Ende dieser Seite
Grund dafür ist ein in der Gesellschaft verankerter, defizitärer Blick auf Menschen mit Behinderungen, der sich auch im Sport zeigt. Der Sport ist geprägt von dem Idealbild eines athletischen und leistungsfähigen menschlichen Körpers. Zwar erfüllen auch viele Sportler*innen ohne Behinderungen dieses Idealbild nicht, für Menschen mit Behinderungen gilt dies jedoch in besonderer Weise. Ihnen wird zugeschrieben, weniger leistungsfähig zu sein als Menschen ohne Behinderungen und die von ihnen erbrachten sportlichen Leistungen werden nicht in gleicher Weise wertgeschätzt. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass Menschen mit Behinderungen kein oder nur wenig Interesse am Sport haben. Solche und ähnliche Klischees und Vorurteile sind behindertenfeindlich bzw. «ableistisch». Damit ist gemeint, dass Menschen, die nicht den gesellschaftlichen Vorstellungen über «normale» Körper und Fähigkeiten entsprechen, als «anders» oder «unnormal» gelten und aufgrund dessen Diskriminierung erfahren (vgl. Ableismus).
Menschen mit Behinderungen sind keine einheitliche Gruppe. Sie leben mit zum Teil sehr unterschiedlichen Formen von Behinderungen; manche mit einer sichtbaren Behinderung, manche mit einer unsichtbaren. Auch im Sport gilt es, diese «Vielfalt in der Vielfalt» anzuerkennen.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Menschen mit Behinderungen auch aufgrund anderer Merkmale zusätzlich Diskriminierungserfahrungen machen (können). Das kann zum Beispiel aufgrund ihres Geschlechts sein. So erleben es Menschen mit Behinderungen, dass sie aufgrund ihrer Behinderung nicht den gesellschaftlich gängigen Geschlechtervorstellungen entsprechen. Die Vorstellung über «normale» Männer und Frauen ist eng verbunden mit der Vorstellung eines nicht-behinderten Körpers. Der Sport wiederum ist bis heute von traditionellen Geschlechterbildern geprägt. Männer mit Behinderungen sehen sich daher häufig mit dem Vorurteil konfrontiert, nicht leistungsfähig und männlich genug zu sein. Frauen mit Behinderungen hingegen müssen ihr Frausein und ihre Weiblichkeit im Sport oft doppelt beweisen. Denn ihr Körper entspricht erstens aufgrund der Behinderung häufig nicht den gesellschaftlichen Schönheitsidealen für Frauen. Zweitens sehen sich Sportlerinnen mit dem Vorwurf konfrontiert, nicht weiblich genug zu sein. Das ist vor allem so, wenn sie im Leistungssport und/oder in einer typischen Männersportart aktiv sind. Geschlecht und Behinderung und die damit verbundenen gesellschaftlichen Vorurteile und Klischees sind also miteinander verknüpft und das führt zu jeweils spezifischen Diskriminierungserfahrungen (siehe auch Sport und Geschlecht).
Ein ähnlicher Zusammenhang lässt sich in Bezug auf das Thema Armut & Prekarität feststellen. Auch in der Schweiz sind Menschen mit Behinderungen in höherem Masse von Armut betroffen als Menschen ohne Behinderungen. Das hat Auswirkungen auf die Möglichkeiten ihrer Teilhabe an Sportangeboten und kann zu sozialen Ausschlüssen führen (siehe auch Armut/Prekarität).
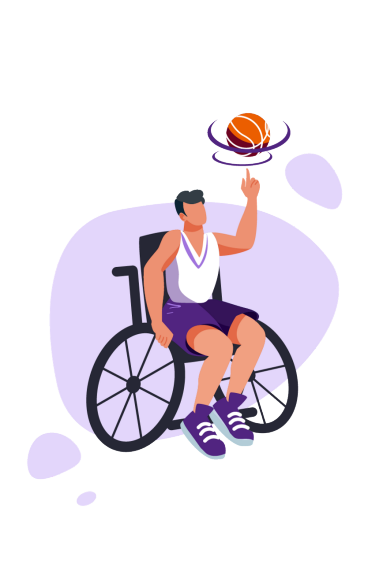
Im Sport engagierte Menschen, wie u. a. Kursleitende und Trainer*innen, können durch ihre Haltung und ihr Handeln Behindertenfeindlichkeit begegnen und dazu beitragen, dass immer mehr Sportangebote für Menschen mit und ohne Behinderungen zugänglich sind.
Um Behindertenfeindlichkeit im Sport zu erkennen und den Sport inklusiv gestalten zu können, ist es wichtig, dass vor allem Sportler*innen und Sportleitende ohne Behinderungen ihre Klischees und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen im Sport hinterfragen.
- Erweitern Sie gemeinsam mit Menschen in Ihren Sportvereinen/Sportorganisationen, Ihr Wissen über Menschen mit Behinderungen und über Behindertenfeindlichkeit im Sport. Sprechen Sie offen über Klischees und Vorurteile und hinterfragen Sie die damit verbundenen Leistungs- und Körpernormen.
- Gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass Menschen mit Behinderungen ein genauso grosses Interesse an Sport und Bewegung haben wie Menschen ohne Behinderungen.
- Machen Sie sich bewusst, dass nicht jede Behinderung sichtbar ist. Gehen Sie also davon aus, dass in jeder Sportgruppe, die Sie leiten und begleiten, auch Menschen mit Behinderungen anwesend sind.
Inklusive Sportangebote richten sich an Menschen mit und ohne Behinderung. Ein Sportangebot kann von Beginn an inklusiv geplant werden. Es kann aber auch sein, dass ein Verein ein Sportangebot inklusiv gestalten will, um z.B. der Anfrage von Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen nachzukommen.
- Entscheiden Sie gemeinsam mit Menschen in Ihrer Organisation/Verein, ob und wie ein inklusives Sportangebot (z.B. für Kinder und Jugendliche) gestaltet werden kann. Nutzen Sie Möglichkeiten, finanzielle und beratende Unterstützung zum Beispiel bei Plusport, Special Olympics oder bei J+S einzuholen (siehe wo finde ich Unterstützung)
- Klären Sie Fragen der Zugänglichkeit/Barrierefreiheit in Bezug auf die Sportstätten in denen Sie mit Ihrem Verein/Ihrer Organisation aktiv sind (Parkplätze, Umkleiden und Sanitäranlagen etc.).
Die Auseinandersetzung dem Thema Inklusion und Behindertenfeindlichkeit setzt auch einen bewussten Umgang mit Sprache voraus.
- Machen Sie sich bewusst, dass Menschen nicht an einer Behinderung «leiden». Menschen leben mit einer Behinderung und sie sind mehr als ihre Behinderung. Formulierungen wie «Menschen mit Behinderungen» stellen den Menschen in den Vordergrund.
- Der Begriff Behinderung verweist darauf, dass Menschen nicht behindert sind, sondern durch gesellschaftliche Bedingungen und Gegebenheiten behindert werden. Im Sport findet sich auch der Begriff der Beeinträchtigung. Dieser verweist auf individuelle körperliche, geistige oder psychische Einschränkungen und wird deshalb auch kritisch gesehen.
- Falls Sie in Infomaterialien oder zum Vermitteln einer Sportart Schaubilder, Fotos oder Technik-Videos einsetzen, achten Sie darauf, dass Sie Menschen mit unterschiedlichen äusserlichen Erscheinungsbildern in Aktion zeigen. Es ist wichtig, dass Vielfalt sichtbar wird (auch in Bezug auf Behinderungen, Geschlechter, Alterskategorien etc.).
Wer sportliche Aktivitäten plant und anleitet, ist im Rahmen des Kurses/Trainings dafür verantwortlich, für alle Beteiligten einen sicheren, diskriminierungsfreien Raum zu gewährleisten. Die Art und Weise, wie Kursleitende und Trainer*innen auf Grenzüberschreitungen und verletzende Äusserungen reagieren, bestimmt die Atmosphäre und die geltenden Regeln des Miteinanders.
- Kommunizieren Sie deutlich, dass Sie von den Teilnehmenden gegenseitigen Respekt und Fairness erwarten (z.B. keine sexistischen, homo-, trans- und behindertenfeindlichen, rassistischen oder sonst diskriminierende Sprüche).
- Intervenieren Sie sofort, wenn eine teilnehmende Person verbal oder nonverbal diskriminiert, beleidigt, unfair behandelt oder abgewertet wird. Weisen Sie die diskriminierend handelnde Person ruhig auf ihr Fehlverhalten hin. Wählen Sie dabei eine klare, gewaltfreie Sprache.
- Es ist wichtig, Diskriminierung auch dann zu begegnen, wenn nicht direkt von der Diskriminierung betroffene Menschen vor Ort sind. Sprüche wie «Das war aber ein schwuler Pass», «Bist du behindert?» oder «Du wirfst wie ein Mädchen» sind auch dann diskriminierend, wenn kein schwuler Sportler, kein Mensch mit einer Behinderung oder Mädchen und Frauen anwesend sind.
- Reagieren Sie, je nach Situation, vor/mit der ganzen Gruppe oder suchen Sie klärende Einzelgespräche nach dem Kurs oder Training. Dokumentieren Sie den Vorfall und melden Sie ihn, sollte die diskriminierend handelnde Person ihr Verhalten nicht ändern.
- Bemühen Sie sich, in Konfliktsituationen zwischen Teilnehmenden offen und gerecht zu vermitteln und mögliche Sanktionen mit Augenmass zu treffen. Suchen Sie gemeinsam nach Lösungen, wie eine solche Situation in Zukunft vermieden werden kann. Dies stärkt längerfristig das gegenseitige Vertrauen.